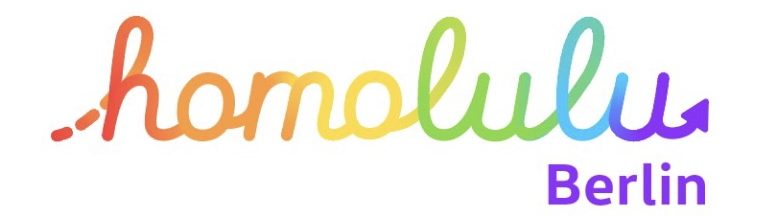Jürgen Baldiga (1959-1993)
71 - Ehemaliges SchwuZ 1987-1995, Ort der SchwuZ-Tunten
heute Höfe am Südstern, Hasenheide 54, Berlin-Kreuzberg
Jürgen Baldiga war ein bedeutender schwuler Künstler und Fotograf, der das queere Leben im West-Berlin der 1980er und frühen 1990er Jahre wie kein anderer dokumentierte. Etwa zeitgleich als Baldiga von seiner HIV-Infektion erfuhr, begann er auch zu fotografieren. Baldiga entwickelte sich zum wichtigsten Chronisten der West-Berliner Schwulenszene und der Tunten-Kultur. Er lebte ein wildes, zu kurzes Leben, das aufgrund seiner Aids-Erkrankung bereits 1993 endete.
weiterlesen
(dieser Text ist auch im Audio-Clip zu hören)
Aufgewachsen als Bergarbeiter-Sohn in Essen, kam Baldiga 1979 als 19-jähriger nach West-Berlin, wo er zunächst als Koch und Sexarbeiter sein Geld verdiente. Doch schon bald entdeckte er seine Berufung: die Kunst und insbesondere die Fotografie als Chronist der Berliner Schwulenszene. Er lebte uneingeschränkt sexpositiv bevor es diesen Begriff gab, war voller Energie und eine Rampensau. „Ich will leben. Jeden Tag genießen. Es macht Spaß, es macht geil, es ist die Freiheit der Sexualität“. In seinem Tagebuch notierte er „Kunst und Ficken — das ist mein Leben. Ich liebe mein Leben. Es ist wie ein Trip. Ein ewiger.“
Seine Kunst war radikal und seine Fotografien zeigen ein ungeschöntes, authentisches Bild des queeren Undergrounds, voller Ehrlichkeit mit sich und anderen. Mit seiner Kamera fing er Momente ein, die andere oft übersahen: wilde Partys, intime Begegnungen, aber auch die Schattenseiten des Lebens am Rande der Gesellschaft.
Zunächst war er zurückhaltend und fotografierte nur Füße, weil er sich nicht traute, Menschen intimer zu begegnen. Doch dann kam er auf der Straße mit Menschen ins Gespräch: Junkies, Sexarbeiter, Menschen mit Behinderung, Drag Queens. Er quatschte sie an, begegnete allen auf Augenhöhe und porträtierte sie mit einer besonderen Direktheit, Nähe und Wärme. Er schrieb: „Ich bin an Menschen interessiert, die am Rande der Gesellschaft stehen und ihre Mitte gefunden haben.“
Besonders fasziniert war Baldiga von den sogenannten „SchwuZ-Tunten“, Drag Queens und gender-nonkonforme Personen, die sich selbstbewusst inszenierten, wie Melitta Sundström und Pepsi Boston. Damals befand sich der Club SchwuZ im Hinterhaus der Hasenheide 54, heute sind dies die Höfe am Südstern. Seine ab 1987 fotografierten Portraits sind voller Respekt und Zuneigung. Wie er sagte zeigen sie „Menschen, die sich selbstbewusst als Tunten verstanden und inszenierten, mit Perücken und Modeschmuck aus der Altkleidersammlung und einem Lidschatten und Selbstbewusstsein zum Niederknien„.
Ende 1984 erfuhr Baldiga, dass er HIV-positiv war. In einer Zeit, als eine HIV-Infektion noch einem Todesurteil gleichkam, begann er, sein Leben und seinen sich verändernden Körper mit noch größerer Intensität zu dokumentieren. Seine Arbeiten aus dieser Zeit sind schonungslos ehrlich und zeigen sowohl die Verzweiflung als auch den unbändigen Lebenswillen, der ihn antrieb. Um sich und seine HIV-Erkrankung zu dokumentieren, bat er den Fotografen Aaron Neubert ihn einmal pro Monat bis zu seinem Tod zu fotografieren. Diese Foto-Serie „Wärme, die nur Feuer uns geben kann“ ist digital verfügbar, (siehe weiterführende Links)
Baldiga wurde zu einem wichtigen Aktivisten im Kampf gegen AIDS und die damit verbundene Stigmatisierung. Er engagierte sich in Selbsthilfegruppen und nutzte seine Kunst, um auf die Situation von HIV-positiven Menschen aufmerksam zu machen.
Am 4. Dezember 1993, im Alter von nur 34 Jahren, nahm sich Baldiga das Leben, erschöpft von seiner Krankheit. Für seinen Nachruf wählte er selbst ein Foto aus, das ihn mit blutunterlaufenen Augen und einer roten Clownsnase zeigt – ein letztes, kraftvolles Statement eines Künstlers, der bis zuletzt die Kontrolle über sein Bild und seine Geschichte behalten wollte.
Baldigas künstlerisches Schaffen war vielfältig. Neben vier Bildbänden und 5.000 Fotografien hinterließ er auch Super-8-Filme, Musikaufnahmen und vor allem 40 Bände mit Tagebucheinträgen, transkribiert in über 7.000 PDF-Seiten. Diese Tagebücher geben einen intimen Einblick in sein Leben und die queere Szene Berlins.
Baldigas Nachlass ist Teil des Archivs des Schwulen Museums Berlin. Seine Fotografien schmückten die Wände des legendären Berliner Clubs SchwuZ, den Baldiga an dessen früheren Orten oft besuchte und dokumentierte . Der Club musste 2025 leider schließen.
2019 und 2024 entstanden zwei Dokumentarfilme, „Rettet das Feuer!“ und „Baldiga – Entsichertes Herz“, die sein Leben und Werk einem breiteren Publikum zugänglich machen.
Jürgen Baldiga ist auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg beigesetzt. Direkt daneben befindet sich das Grab des queeren Filmverleihers Manfred Salzgeber der 1994 ebenfalls an AIDS verstarb. Es ist ein Ort des queeren Gedenkens an die Opfer der Aids-Pandemie.
Weitere Orte mit Jürgen Baldiga
Weitere Audio-Beiträge hier am Ort:
Bildergalerie Jürgen Baldiga






Weitere Orte & Audio-Beiträge
Weitere Audio-Beiträge in der Nähe:
Weiterführende Links & Quellen:
- Foto-Serie „Wärme, die nur Feuer uns geben kann“ von Aron Neubert, 27 Bilder – ein Foto pro Monat von Baldiga bis zu dessen Tod
- Podcast-Episode „Baldiga“ – Doku über einen außergewöhnlichen Künstler und die AIDS-Epidemie“ aus dem Podcast „Kompressor“, 2024, Dauer 8min (nicht mehr verfügbar)
- Dokumentarfilm „Baldiga – Entsichertes Herz“ von Markus Stein
- Video-Interview mit Markus Stein über den Dokumentarfilm „Berlinale Talk 2024 – Baldig – Entsichertes Herz„
- Dokumentarfilm „Rettet das Feuer!“ von Jasco Viefhues, 2019; auch verfügbar in den Bibliotheken Berlins
- Online-Ausstellung mit Fotografien von Jürgen Baldiga
Hinweis zu den Begrifflichkeiten:
Die in den Texten verwenden Begriffe entsprechen zu weiten Teilen denen, die zur Zeit der queeren Held*innen üblich waren, so zum Beispiel das Wort „Transvestit“, welches von einigen Personen auch als Selbstbezeichnung gewählt wurde. Dies würden wir heute viel differenzierter ausdrücken, unter anderem als Trans*, Crossdresser, Dragking, Dragqueen, gender-nonkonform oder nicht-binär. Sofern möglich, werden die Bezeichnungen benutzt, die eine betreffende Persönlichkeit (vermutlich) für sich selbst gewählt hat. Jedoch wissen wir teilweise nicht, wie sich historische Personen selbst benannt haben oder wie sie sich mit dem heutigen Wortschatz beschreiben würden.
Zudem wird auch das Wort „queer“ verwendet, welches zur Zeit der meisten beschriebenen queeren Held*innen noch gar nicht existierte. Dennoch ist es heute das passendste Wort, um inklusiv all die zu bezeichnen, die nicht der heterosexuellen Cis-Mehrheit entsprechen.
Ein Projekt von Rafael Nasemann angegliedert an die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin.
Gefördert durch die Hannchen-Mehrzweck-Stiftung – Stiftung für queere Bewegungen

Die Karte wurde mit dem WP Go Maps Plugin erstellt. Danke für die kostenlose Lizenz https://wpgmaps.com
© 2026 – Rafael Nasemann, alle Rechte vorbehalten